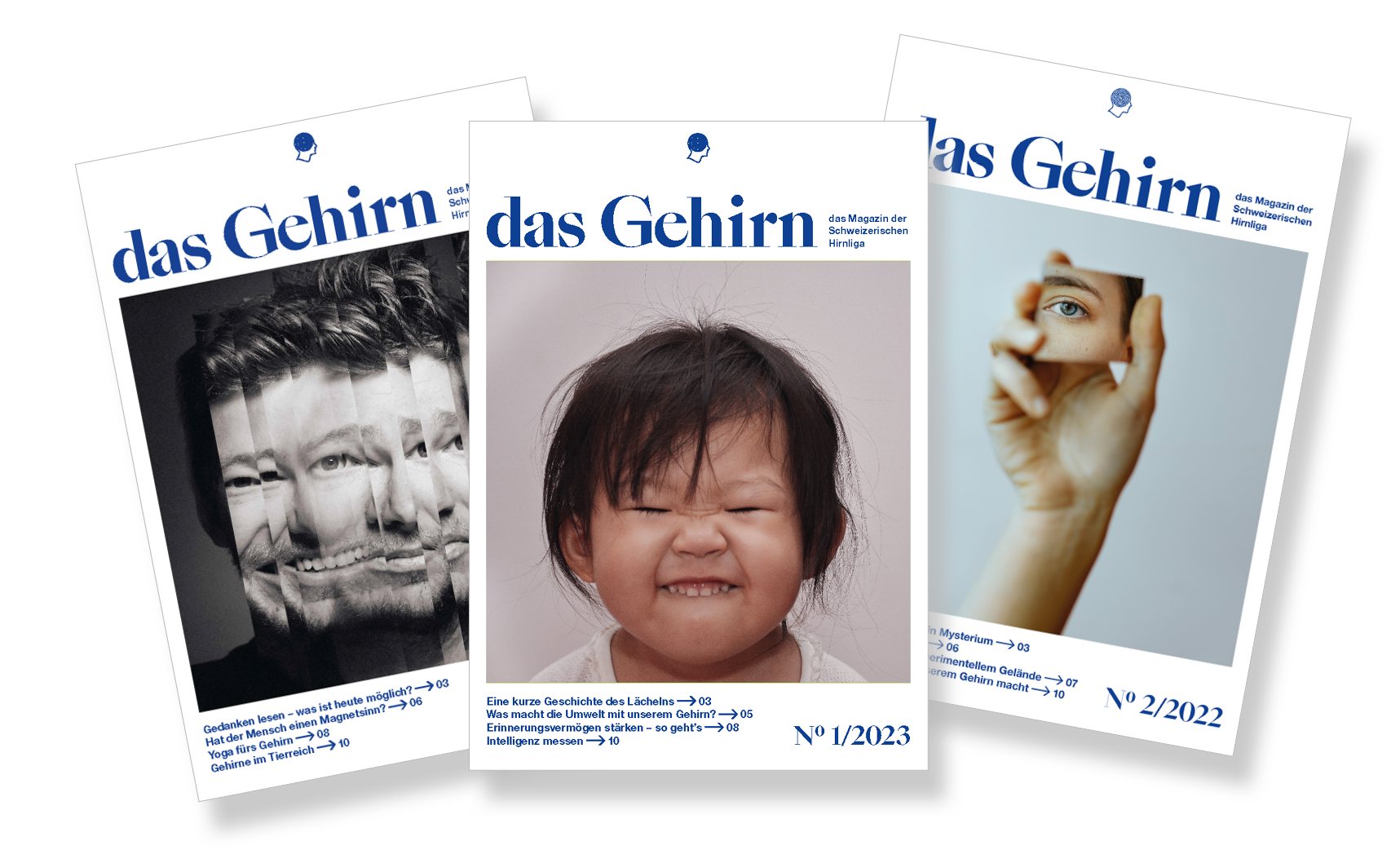Wie wir werden, was wir sind

An seinem 38. Geburtstag zog der französische Philosoph Michel de Montaigne einen radikalen Schnitt. Er legte sein Richteramt nieder, zog sich in seine Privatbibliothek zurück und verbrachte den Rest seines Lebens damit, Essays über den komplexen, schwer fassbaren und wandelbaren Gegenstand zu schreiben, den ihn am meisten faszinierte: sich selber. Es war ein verrücktes Unterfangen, wie er alsbald feststellte, denn seine Persönlichkeit änderte sich ständig und entzog sich einer eindeutigen Beschreibung. Das hinderte Michel de Montaigne keineswegs, weiterzuforschen, Fragen zu stellen und Erklärungen zu suchen. Generationen von Denkerinnen und Denkern haben sich seither mit dem Problem beschäftigt: Wie werden wir, was wir sind? Ist die Persönlichkeit durch die Umwelt bestimmt und welche Rolle spielen die Gene? Heute sieht man Vererbung und Umwelt nicht mehr als gegensätzliche Pole, sondern als Teile eines Ganzen an.
Was ist Persönlichkeit?
Wenn wir von Persönlichkeit sprechen, meinen wir zweierlei Dinge: Das Temperament und den Charakter. Das Temperament zeigt sich in emotionalen Reaktionen, es ist zu einem grossen Teil angeboren und bleibt relativ stabil. Der Charakter entwickelt sich im Laufe des Lebens, er ist geformt von kulturellen Einflüssen und persönlichen Erfahrungen.
Unsere Persönlichkeit lässt sich mit fünf wesentlichen Eigenschaften definieren, die so genannten „Big-Five“. Diese Eigenschaften haben sich in einer international durchgeführten Analyse von 18'000 möglichen Merkmalen herauskristallisiert. Zu den so genannten „Big-Five“-Eigenschaften zählen Extraversion (Geselligkeit), Offenheit für neue Erfahrungen (Interesse an neuen Erlebnissen, Eindrücken), Verträglichkeit (Kooperationsbereitschaft), Gewissenhaftigkeit (Sorgfalt, Zuverlässigkeit) und emotionale Stabilität (Ausgeglichenheit, Entspanntheit). Wie verteilen sich diese Eigenschaften auf die verschiedenen Altersgruppen? Verändern sich die Charakterzüge im Laufe des Lebens oder bleiben sie stabil?
Gewissenhaftigkeit steigt im mittleren Alter an...
Das Team um die deutsche Wissenschaftlerin Jule Specht untersuchte die Persönlichkeitsmerkmale von 15'000 Teilnehmern zwischen 16 und 82 Jahren in einem Vier-Jahres-Zeitraum. Die grössten Unterschiede zwischen den Altersgruppen zeigten sich in der Gewissenhaftigkeit. Junge Erwachsene sind im Schnitt noch eher planlos und unstrukturiert. Das scheint sich jedoch bis zum Alter von ungefähr 40 Jahren zu ändern. Zwischen 20 und 40 Jahren steigt die Gewissenhaftigkeit rasant an. Auch die Verträglichkeit scheint im Lauf des Lebens zuzunehmen, aber eher im höheren Alter, jenseits der 60. Die Offenheit für Erfahrungen jedoch sinkt mit der Zeit: So interessierten sich die älteren Teilnehmer im Allgemeinen weniger für moderne Kunst oder technische Innovationen. Die emotionale Stabilität sowie die Geselligkeit waren auf alle Altersstufen ungefähr gleich verteilt.
...und nimmt nach der Pensionierung ab
Welchen Einfluss haben Lebensereignisse wie der Berufseintritt oder die Pensionierung auf die Persönlichkeit? Hier zeigt sich ein interessanter Effekt: Die von Specht analysierten Daten zeigten, dass die Gewissenhaftigkeit nach dem Berufseintritt im Allgemeinen stark zunimmt, während sie ab dem Renteneintritt wieder sinkt. „Das Arbeitsleben verstärkt ganz offenbar den Hang zu einem überlegten Vorgehen sowie die Einsatzbereitschaft. Fällt diese Anforderung im Alter dann auf einmal weg, sinkt der Anspruch an sich selber. Psychologen bezeichnen dieses Phänomen auch als „Dolce Vita“-Effekt“, so Specht.
Der Einfluss der Gene
Und welche Rolle spielen die Gene? Der grösste genetische Einfluss zeigt sich bei der Geselligkeit und der emotionalen Stabilität. Stark wirken Gene auch beim Konservativismus, dem Gegenstück zur Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Dagegen scheinen Umweltfaktoren bei der Religiosität und dem kirchlichen Engagement entscheidender zu sein. Auch für die Einstellung gegenüber Fremden oder Menschen anderer Ethnien liess sich kein wesentlicher genetischer Einfluss feststellen.
Inwieweit Gene die Persönlichkeitsentwicklung bestimmen, untersuchen Forscher anhand von eineiigen, genetisch identischen Zwillingen. „Fasst man die Resultate der verschiedenen Zwillingsforschungsprojekte zusammen, so ergibt sich der Schluss, dass der Einfluss der Gene auf die Persönlichkeit beträchtlich sein kann. Trotzdem können aber Umweltfaktoren entscheidend sein“, erklärt der Neurowissenschaftler Norbert Herschkowitz.