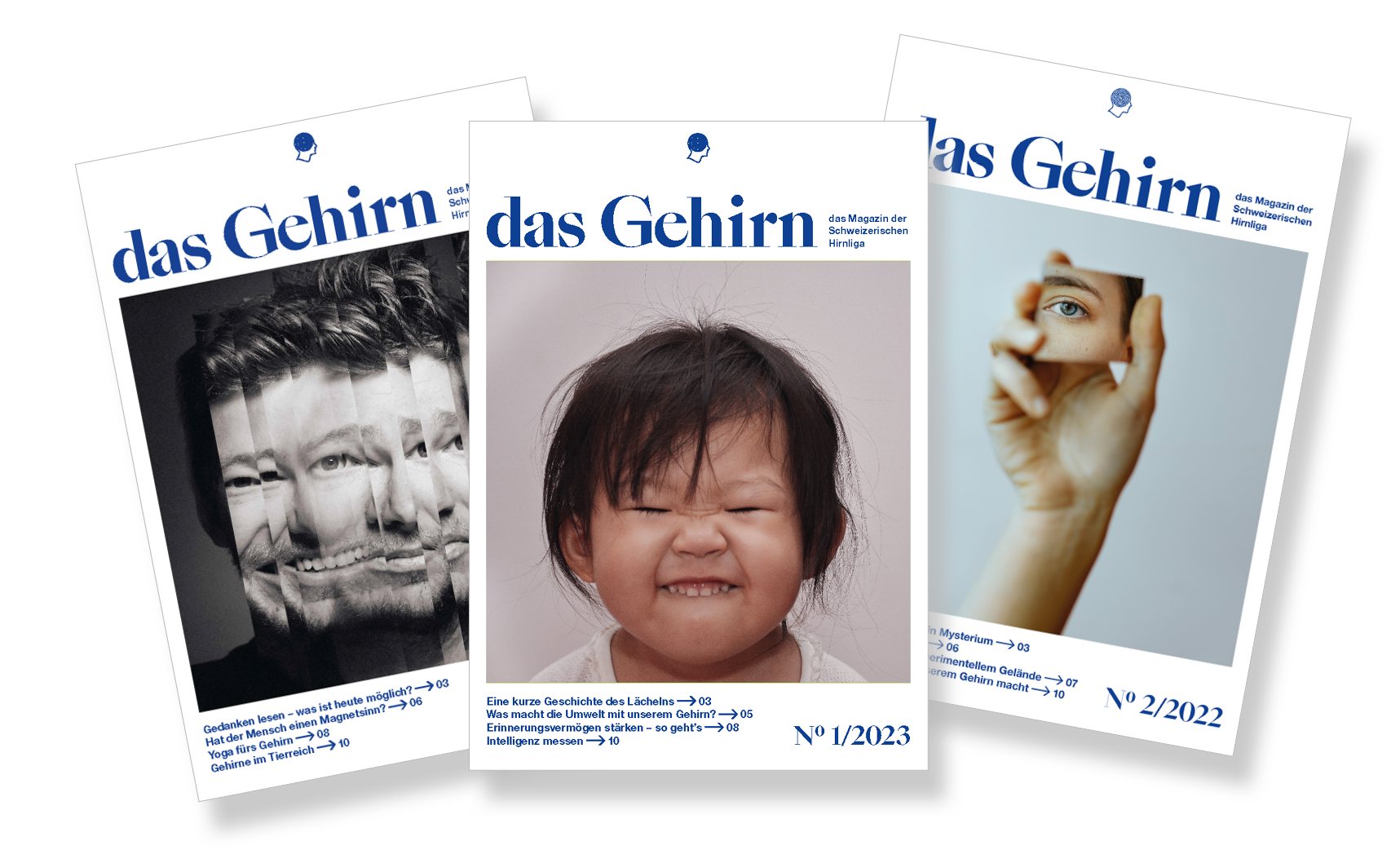Aus Falschem lernen, was richtig ist
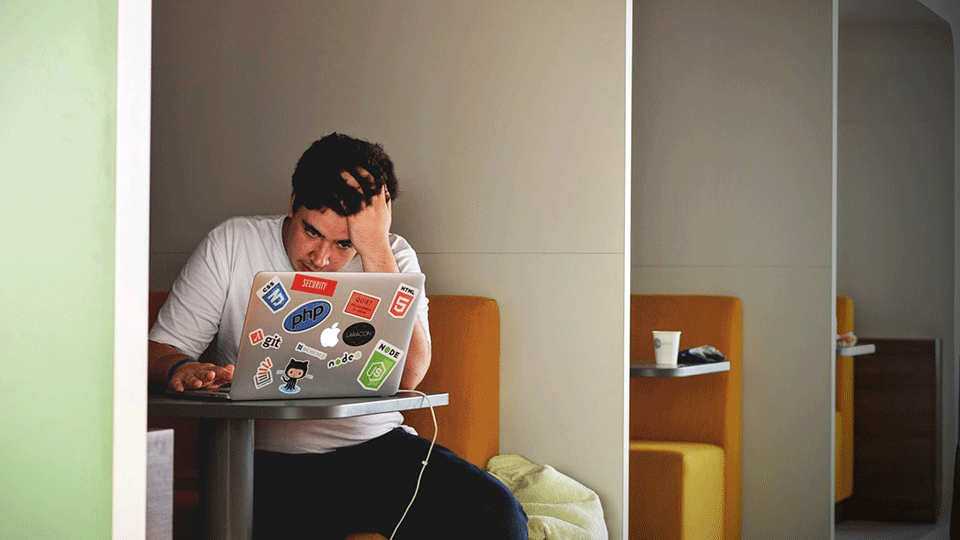
Eine psychologische Theorie besagt, dass wir besser wissen, was richtig ist, wenn wir auch gelernt haben, was falsch ist. In der Schule hat das konkrete Auswirkungen auf den Unterricht.
Nirgends werden Fehler so gründlich beobachtet und bewertet wie in der Schule. Kinder üben so mit Kritik umzugehen, ihre Fehler zu analysieren und daraus zu lernen, damit es beim nächsten Mal besser klappt. Zumindest wäre dies der Idealfall. Der Schweizer Pädagoge und Psychologe Fritz Oser, emeritierter Professor an der Universität Freiburg, hat das Fehlerverhalten in Schulen erforscht. Dabei fragt er nicht, wie die Schüler Fehler vermeiden können. Viel wichtiger ist die Art und Weise, wie Lehrer mit Fehlern umgehen.
Beobachten oder hören genügt
Lernen bedeutet nach Fritz Oser, aktiv Wissen zu erwerben und Erfahrungen zu machen. Dabei dürfen Fehler passieren. Die Schüler erhalten so Informationen über Schwächen und Mängel, die im Ernstfall nicht auftreten dürfen. Lernen aus Fehlern heisst auch Grenzen zu erfahren.
Ein typisches Beispiel für einen solchen Lernprozess ist die Ausbildung eines Piloten. Im Flugsimulator lernt er vor allem, was er in kritischen Situationen nicht tun darf, weil dies einen Absturz oder einen Unfall verursachen würde. Oser bezeichnet dieses Wissen – was man besser nicht tun soll oder wie etwas nicht funktioniert – als negatives Wissen. Es kann durch eigene Erfahrungen erworben werden, aber auch beim Beobachten oder Hören von Fehlern anderer. Die Kindergärtler hören vom Verkehrspolizisten, dass ein Unfall passiert, wenn sie die Strasse bei Rot überqueren. Auch wenn sie diesen Fehler hoffentlich nie selber machen, haben sie gelernt, das falsche Verhalten zu vermeiden.
Falsche Antworten nicht übergehen
Was bedeutet das für den Lehrer? Er muss wissen, dass ein Kind besonders viel lernt an dem, was es falsch macht. Dazu sind aber einige Voraussetzungen nötig: Das Kind muss erkennen, was falsch war; es muss verstehen, wie es dazu kam; und es sollte den Fehler korrigieren können. Das ist nur möglich, wenn der Lehrer sich die Zeit nimmt und auf den Fehler eingeht. Bei einer falschen Antwort einfach den nächsten Schüler aufrufen oder das Kind gar blossstellen ist nicht hilfreich. Vielmehr sollte das Diskutieren der Fehler fest in den Unterricht eingebaut werden. Dann können Kinder sich zu kreativen, innovativen und verantwortungsbewussten Menschen entwickeln.