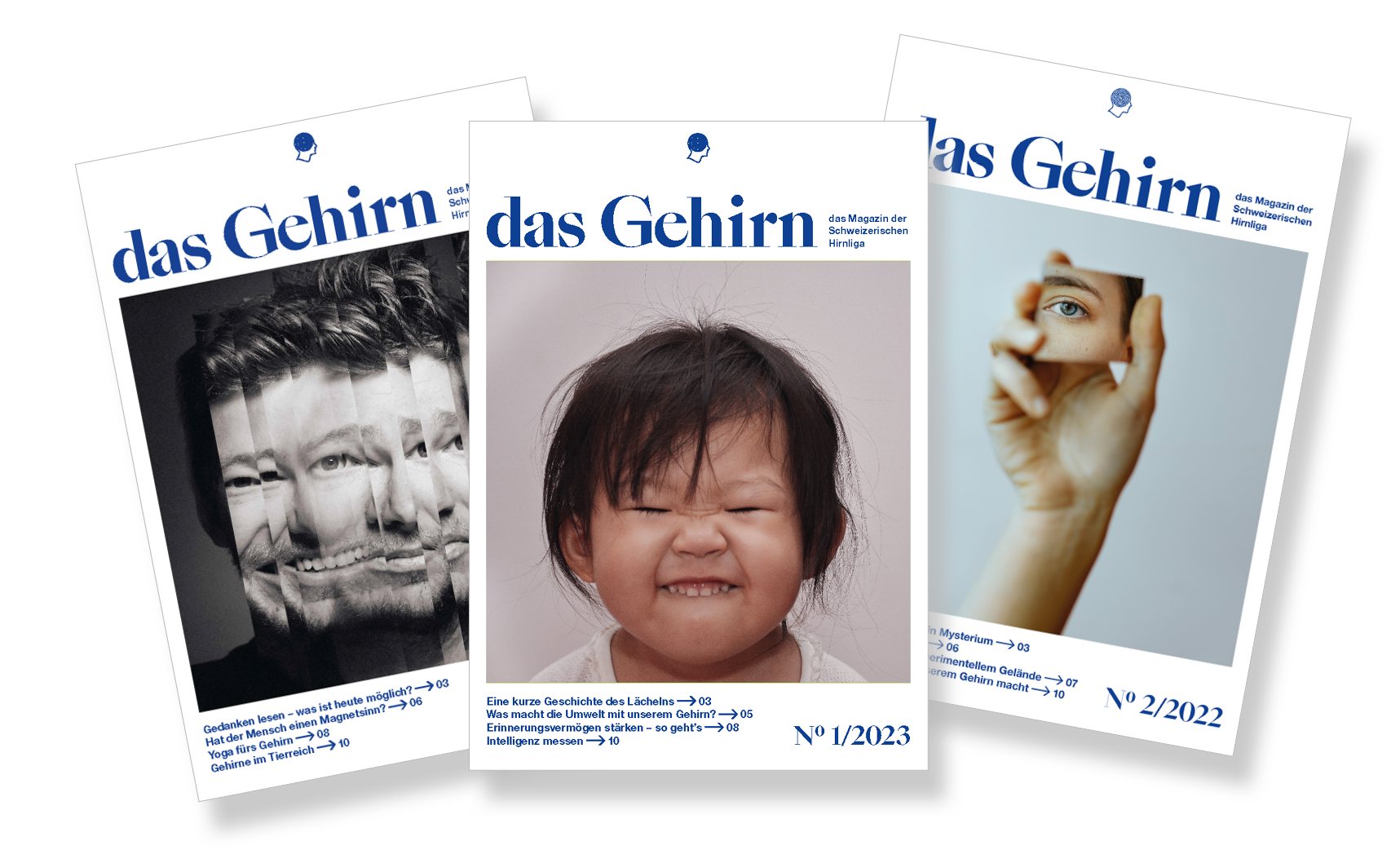Keine Angst vor Emotionen!

«Ihre Blutwerte sind auffällig. Ich möchte die Resultate gerne mit Ihnen besprechen.» Seit Nicole Z. diese Nachricht ihres Arztes auf dem Anrufbeantworter gehört hat, ist sie in einer Art Schockzustand. «Sind das die Anzeichen einer schlimmen Krankheit? Auf was muss ich mich gefasst machen?» Nicole hat Angst, dunkle Gedanken rasen ihr durch den Kopf. Ein Rückruf beim Arzt könnte die Sache klären. Doch Nicole ist wie gelähmt.
Emotionen können starke körperliche Reaktionen auslösen: Zittern, Herzklopfen, Anspannung. Der englische Philosoph Thomas Hobbes bezeichnete Leidenschaft und Gefühle nicht ganz zu unrecht als «Störungen des Geistes». Für die Entwicklung der Menschheit brachten sie aber einen Überlebensvorteil: Emotionen versetzen uns in eine Handlungsbereitschaft. So lässt der Anblick einer Schlange das Herz schneller schlagen, der Blutdruck steigt, wodurch die Muskeln mit Blut versorgt werden. Hormone sichern eine optimale Energieversorgung der Muskulatur und lenken die Konzentration auf die mögliche Bedrohung. All das schafft die idealen Voraussetzungen für zwei Reaktionsmöglichkeiten: Kampf oder Flucht.
Wir sind unseren Emotionen nicht ausgeliefert
«Emotionen beherrschen unseren Verstand mehr als umgekehrt», resümiert der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth. Doch sind wir ihrer Macht nicht hilflos ausgeliefert. Wie wir mit unseren Emotionen umgehen, ist zwar zu einem grossen Teil in unseren Genen angelegt. Wer zu Wut, Angst oder Traurigkeit neigt, wird diese Eigenschaften nicht plötzlich ablegen. Doch können Menschen auch noch im fortgeschrittenen Alter lernen, damit umzugehen. Das verdanken wir der Plastizität des Gehirns. Mit gezieltem Training lassen sich emotionale Schaltkreise verändern und neue Verhaltensweisen erlernen.
Emotionen konstruktiv nutzen
Emotionen einfach zu verdrängen oder herunterzuspielen, wäre allerdings der falsche Weg. Das würde die körperliche Erregung noch vergrössern, denn es braucht viel Energie, eine Fassade aufrechtzuerhalten. «Man sollte Emotionen nicht als Gegner, sondern als Verbündete sehen», sagt Emotionsforscher Matthias Berking. Die Kunst besteht darin, Emotionen zu akzeptieren oder gar konstruktiv zu nutzen.
Ein Ansatzpunkt im Umgang mit Emotionen bietet die Achtsamkeitsmeditation. «Meditation nimmt der emotionalen Erregung die Spitze, sodass man nicht wie eine Reiz-Reaktions-Maschine in automatische Verhaltensmuster rutscht», erklärt der Psychologe Ulrich Ott. Ruht ein Mensch mehr in sich, kann er gelassener in ein unangenehmes Gespräch gehen. Er ist aufmerksamer und lässt sich weniger verunsichern. Meditierende lernen, ihre Gedanken zu beobachten und zu stoppen, bevor sie schlechte Gefühle auslösen.
Literaturtipps:
Ulrich Ott: Meditation für Skeptiker. Verlag Droemer/Knaur.
Matthias Berking: Training emotionaler Kompetenzen. Springer Verlag.