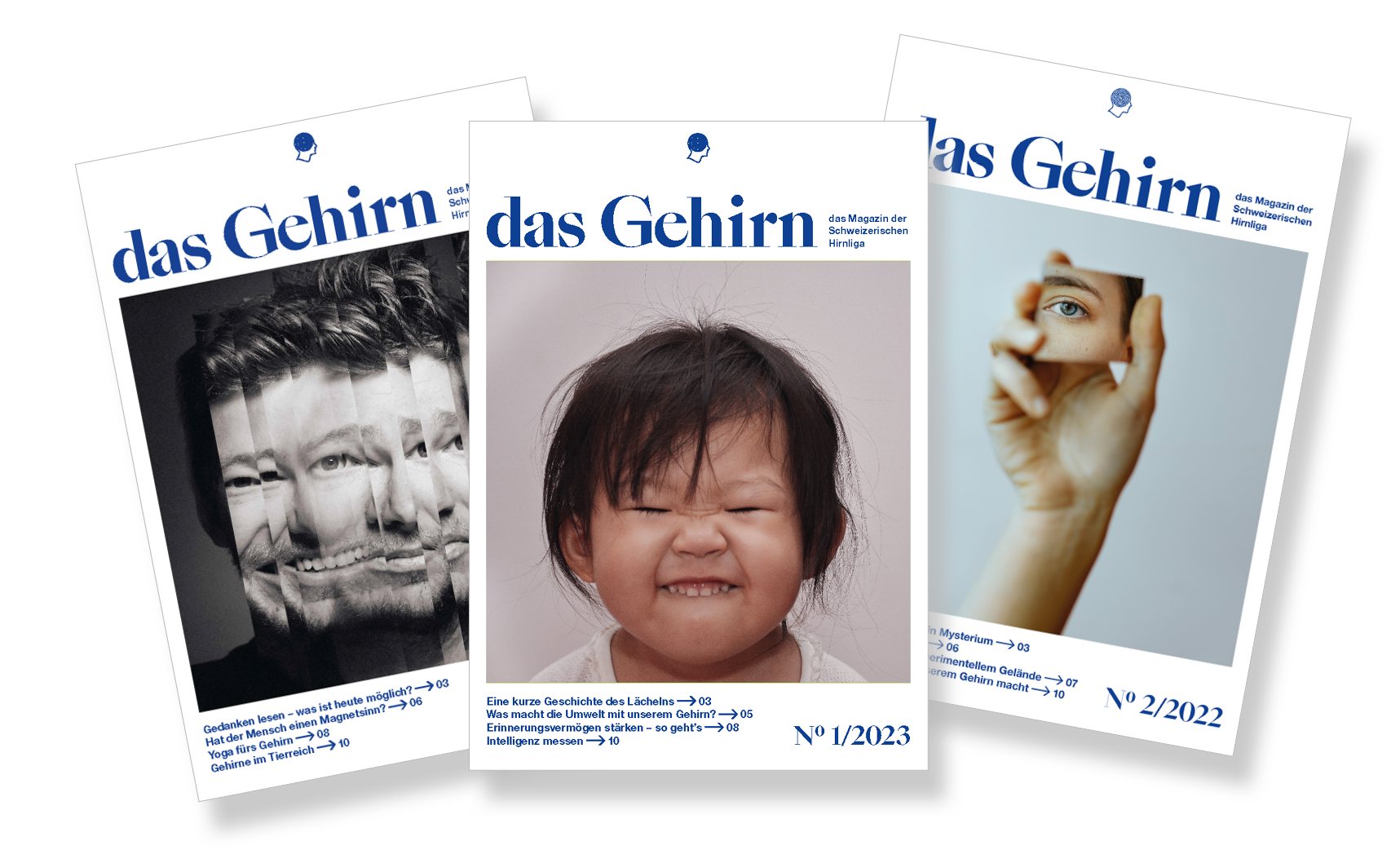Was ist Stress?
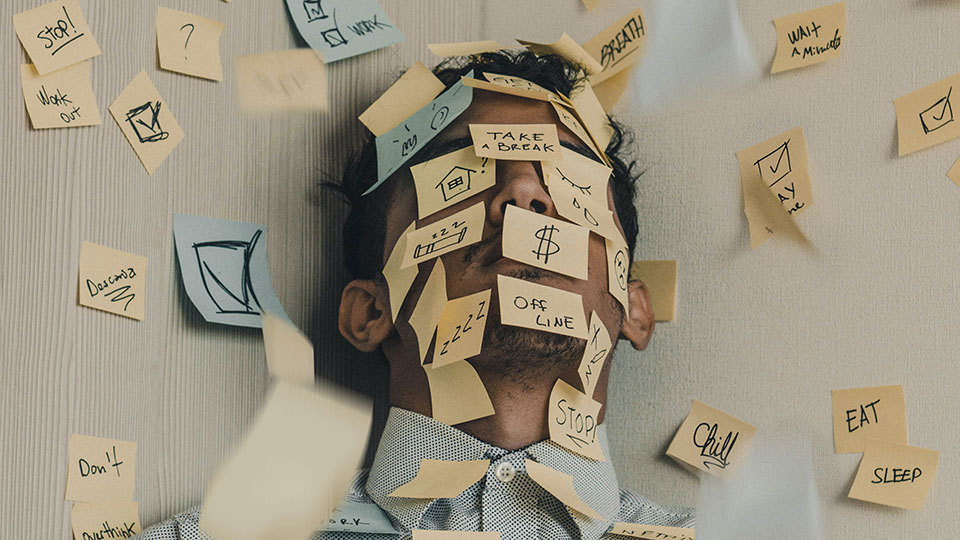
Stress ist eine zwiespältige Angelegenheit. Kurzfristig kann er zu einer besseren Konzentration beitragen und die Kreativität fördern. Langfristiger Stress indes schädigt die Leistungsfähigkeit. Der Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, untersuchte in einem Selbsttest, wie sich Stress im menschlichen Körper auswirkt. Der Naturforscher wollte wissen, ob er seine körperlichen Instinkte durch Vernunft unterdrücken könnte. Dazu legte er sein Gesicht an den Glaskäfig einer lebensgefährlichen Schlange. Während er auf den Angriff der Viper wartete, versuchte er sich zu vergegenwärtigen, dass keinerlei Gefahr bestand. Darwin war fest entschlossen, nicht vor der Schlange zurückzuweichen.
Doch es kam anders. In seinen Aufzeichnungen hielt er fest: «Sobald der Angriff erfolgte, löste sich mein Entschluss in Nichts auf und mit einer ganz erstaunlichen Geschwindigkeit sprang ich ein oder zwei Meter zurück. Mein Wille und meine Vernunft waren gegenüber der eingebildeten Gefahr machtlos.» Wie lässt sich Darwins Beobachtung aus Sicht der modernen Hirnforschung erklären?
Schutz kommt vor Einsicht
Darwins Schreckreaktion wurde durch ein kleines, mandelförmiges Gebiet des Vorderhirns, der sogenannten Amygdala, hervorgerufen. Diese liegt in einem entwicklungsgeschichtlich «alten» Hirnbereich. Informationen der Sinnesorgane, die eine Gefahr anzeigen, bahnen sich einen direkten Weg zur Amygdala. Dabei umgehen die Signale den Cortex, einen entwicklungsgeschichtlich «jüngeren» Hirnbereich, in dem höhere
Gedankenvorgänge wie etwa das vernünftige Denken stattfinden. Zwar gelangen die Informationen der Sinnesorgane über Umwege auch in den Cortex, aber die Amygdala ist schneller. Sie vermag auf eine potentielle Gefahr bereits dann zu reagieren, wenn wir noch gar nicht realisiert haben, was überhaupt los ist. Im entscheidenden Moment, in dem der Cortex noch damit beschäftigt ist, den Stressfaktor zu verarbeiten, ist die Amygdala bereits aktiv und sendet chemische Botenstoffe aus, die eine Flut von Reaktionen im Gehirn und im Körper auslösen.
Kampf- und Fluchtreaktion
Die Amygdala löst die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Das verursacht eine «Kampf- oder Flucht-Reaktion»: Der Blutdruck steigt, der Puls wird schneller und Blut strömt in die Muskulatur
der Gliedmassen, die bei der Verteidigung bzw. der Flucht zum Einsatz kommen. Damit verfügt der menschliche Organismus über die Fähigkeit, in einer gefährlichen Situation schnell zu reagieren und sich zu schützen. Zwar sind moderne Stressauslöser im Allgemeinen nicht mehr so gefährlich wie in der Vorzeit, aber die Reaktion des Gehirns auf Stress hat sich seit jener Zeit kaum geändert.
Wenn anhaltender Stress zu einem dauernden Erregungszustand führt, kommt es zu gesundheitlichen Problemen. In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass schwerwiegender und lange andauernder Stress das Gehirn unmittelbar schädigt, indem er Dendriten zerstört, das sind Fortsätze von Nervenzellen, welche für die Signalübertragung im Gehirn wichtig sind.
Stress schränkt das Denkvermögen ein
Der amerikanische Hirnforscher Bruce S. McEwen ist überzeugt, dass die Menge der Stresshormone, denen wir während unseres Lebens ausgesetzt sind, einen wichtigen Einfluss auf den allgemeinen Alterungsprozess
des Gehirns und des Körpers hat. Dauerstress beeinträchtigt die Konzentrationsfähigkeit, lässt uns wichtige Dinge vergessen und reduziert die Lernfähigkeit. Auch lässt das Interesse an der Umwelt, an Neuem und Unbekanntem nach – zu sehr ist der gestresste Mensch mit sich selbst beschäftigt. Andauernder Stress, so lässt sich resümieren, schränkt unser Denkvermögen ein.
Musse tut Not
Das moderne Leben bringt eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten mit sich. Immer schneller, immer besser: die neuen Technologien machen uns unabhängig von Zeit und Raum. Informationen rund um die Uhr, ständige Erreichbarkeit, Facebook, Internet auf dem Handy: Die Verheissungen der modernen Kommunikationstechnologien entpuppen sich mehr und mehr als Stressfaktor. Musse? Dazu fehlt die Zeit.
Regelmässige Auszeiten sind aber für unsere geistige Gesundheit dringend nötig. Wer dauernd im Hamsterrad rennt, büsst nicht nur Fantasie und Kreativität ein, sondern setzt auch seine sozialen Beziehungen und seine
Gesundheit aufs Spiel. Es ist schwer, sich der Beschleunigung des Lebens zu widersetzen. Das Klagen über einen Mangel an Zeit ist ringsum zu vernehmen. Und trotzdem möchte kaum einer auf die Errungenschaften der modernen Technologien verzichten. Denn bei allem Lamentieren über den Zeitmangel müssen wir uns eingestehen, dass wir diese Beschleunigung unseres Lebens auch geniessen. Vier Hürden stehen uns auf der Suche nach mehr Musse im Weg:
1. Zeitmangel ist kein individuelles Problem, das mit mehr Organisation zu lösen wäre, wie uns die Ratgeberliteratur nahelegen will, sondern ein kollektives Problem. Wer von lauter gehetzten Menschen umgeben ist, kann nicht plötzlich als einziger dem Müssiggang frönen.
2. Wir neigen dazu, Freizeit dem Nützlichkeitsdenken zu unterwerfen: Power Yoga über Mittag, Aerobic nach Feierabend, Wellness am Wochenende. Dabei lautete die ursprüngliche Bedeutung von Musse: «Fernsein von Geschäften oder Abhaltungen».
3. Wir setzen uns einem Erwartungsdruck aus, mit dem wir uns selbst den Weg zum Genuss der freien Zeit verstellen. Das Nichtstun gilt als unproduktiv und öde. Jene wiederum, die keiner produktiven Arbeit nachgehen können, müssen sich in einer Leistungsgesellschaft beim Müssiggang fast zwangsläufig schlecht fühlen.
4. Unser Wohlstand führt zu einer unerschöpflichen Vielfalt an Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung. Aber: je grösser die Auswahl, umso mühsamer die Entscheidung – ein weiterer Stressfaktor.
Paradoxerweise tendieren wir dazu, den Stress mit demselben Mittel zu bekämpfen, der ihn uns beschert hat: mit weiterem Konsum. Entspannungskurse, Entspannungsmusik, Wellness-Ferien. Man müsste hin und wieder mit der fatalen Logik des Immer-Mehr brechen. Wem es gelingt, sich diese Form der Selbstbestimmung zu bewahren, der dürfte am ehesten auch jene innere Ruhe finden, nach der wir uns alle so sehnen.